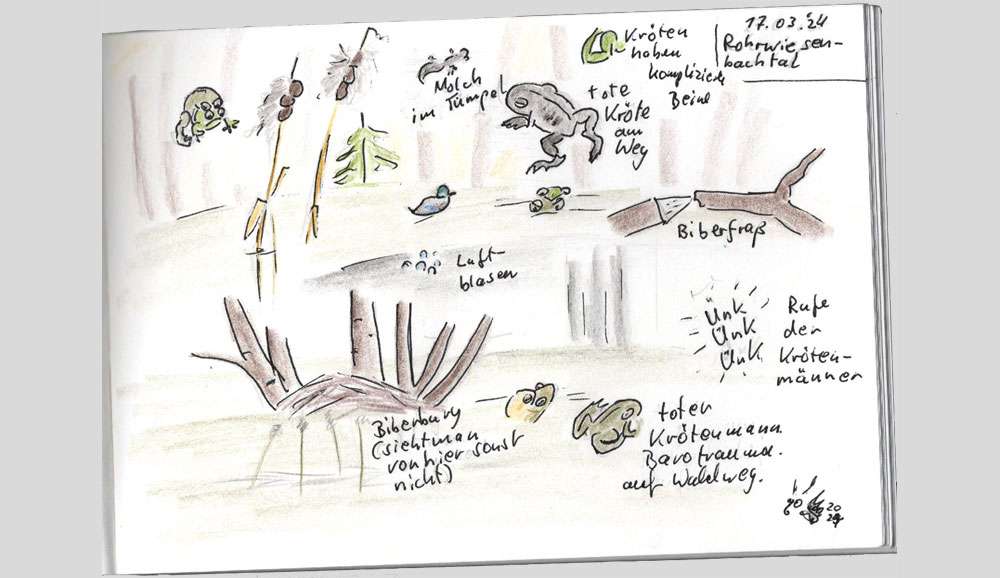ILIAS
.
Ihr findet Natur toll und möchtet endlich mehr erfahren: Warum sind Wegränder in der Feldflur so wichtig für Käfer? Oder weshalb war der gerade gesehene Vogel sicher ein Zilpzalp und kein Fitis, obwohl er ja leider nicht gesungen hat? Dann seid ihr bei uns genau richtig! Einfach hier registrieren und lernen, wann ihr wollt - alle Lernangebote sind kostenlos.
.
.
.
.
Unsere Themenbereiche
Amphibien und Reptilien
Grundwissen Amphibien und Reptilien
Aufbauwissen Amphibien (KNAK)*
Aufbauwissen Reptilien (KNAK)*
Aufbauwissen Amphibien (KNAK)*
Aufbauwissen Reptilien (KNAK)*
Hautflügler
Grundwissen Hautflügler
Kompaktkurs Faltenwespen
Kompaktkurs Hummeln
Aufbauwissen Ameisen
Aufbauwissen Wildbienen
Kompaktkurs Faltenwespen
Kompaktkurs Hummeln
Aufbauwissen Ameisen
Aufbauwissen Wildbienen
Pflanzen
Grundwissen Pflanzen
Kompaktkurs Pflanzen
Grundwissen Moose
Aufbauwissen Farne und Co.
Aufbauwissen Gräser
Kompaktkurs Pflanzen
Grundwissen Moose
Aufbauwissen Farne und Co.
Aufbauwissen Gräser
Schmetterlinge
Grundwissen Schmetterlinge
Kompaktkurs Schmetterlinge
Aufbauwissen Nachtfalter
Aufbauwissen Tagfalter und Widderchen
Kompaktkurs Schmetterlinge
Aufbauwissen Nachtfalter
Aufbauwissen Tagfalter und Widderchen
Vögel
Grundwissen Vögel
Kompaktkurs Vögel
Aufbauwissen Feldornithologie (KNAK)*
Aufbauwissen Greifvögel und Co.
Aufbauwissen Watvögel
Kompaktkurs Vögel
Aufbauwissen Feldornithologie (KNAK)*
Aufbauwissen Greifvögel und Co.
Aufbauwissen Watvögel
*Diese Themen werden außerhalb des durch das Bundesprogramm Biologische Vielfalt geförderten Projekts realisiert.
Bilder (alle NABU-naturgucker.de, außer anders vermerkt): Amphibien und Reptilien (c) Egon Wollwage, Hautflügler (c) Stella Mielke, Heuschrecken (c) Ralph Bergs, Insekten allgemein (c) Ulrich Sach, Käfer (c) Ulrich Sach, Libellen (c) Jens Winter, Mollusken (c) Martina Mechi, Pflanzen (c) Won Poerli, Pilze (c) Rüdiger Fischer, Säugetiere (c) Helene Germer, Schmetterlinge (c) Stella Mielke, Spinnen (c) rottonara/pixabay.com, Vögel (c) Kerstin Kleinke, Wanzen (c) Marion Metzer, Wirbeltiere (c) Regine Schadach, Zweiflügler (c) Jens Winter, Alpen (c) Eugen Zarzycki, Feldflur (c) Pixabay, Fließgewässer (c) Seaq68/Pixabay, Garten (c) Stefanie Biel/NaturGarten e.V., Moor Grundwissen (c) Ulrike Wizisk, Stadtnatur (c) JoachimKohlerBremen/→ CC BY-SA 4.0, Wald (c) Karl Goldhamer, Biodiversität in der Baustoffindustrie (c) Knauf AG, Nature Journaling (c) Katharina Jacob, Umsichtiges Naturgucken (c) Gaby Schulemann-Maier
Kategorien
Kurse
Abbaustätten sind dynamische Lebensräume und bergen großes Potenzial für eine hohe Biodiversität.
Beute fangen, Seide machen und mehr – lernt hier, was Spinnen so besonders macht!
Beim Naturbeobachten beeinflussen wir Tiere, Pflanze, Pilze und Böden. Welche Gesetze regeln dies und wie verhalten wir uns nat…
Inhaltsseiten
Faszinierende Flugkünstler, im Wasser und in der Luft zu Hause und wichtige Zeigerorganismen – all das sind Libellen.